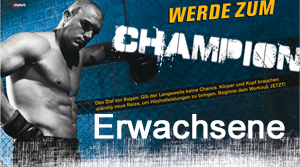Am 19.08.2015 erschien folgender Artikel bei Ansbach Plus:
http://ansbachplus.de/service/gemeinsam-stark-interkultureller-austausch-in-der-kampfsportschule
Wir bedanken uns bei dem gesamten Team für die tolle Berichterstattung!
Sport verbindet – und fördert somit auch den interkulturellen Austausch. Wie Integration zwischen Sandsack und Ring funktioniert, zeigt die Kampfsportschule Ansbach

Die Fäuste sind geballt, die Beinstellung korrekt, die Augen konzentriert auf den schweren, schwingenden Sandsack gerichtet. Reaktion und Treffsicherheit sind das A und O. Schnell und kraftvoll setzt der junge Kickboxer nach vorne und schlägt gegen den Sandsack.
„Immer schön die Deckung oben halten“, mahnt ein Mann in einem schwarzen Trainingsanzug, der sich an den Ring lehnt und die Szene beobachtet. Es ist Mehdi Pestisha, der Trainer der Kampfsportschule Ansbach. Seit seiner frühen Kindheit trainiert der 38-Jährige verschiedene Kampfkünste. „Angefangen habe ich damals mit Kyokushin-Kai-Karate“, erklärt er.
Damals, das war Anfang der 1980er Jahre, im ehemaligen Jugoslawien. Dort wächst Pestisha auf und entdeckt seine Liebe zum Kampfsport. „Ich war sehr zielstrebig. Mit zehn Jahren schaffte ich es bereits ins Nationalteam“, erinnert er sich. „Damals fuhr ich zu vielen Turnieren. Ein paar Mal wurde ich sogar Landeschampion, das war ein überwältigendes Gefühl.“ Mit jedem Sieg wachsen seine Motivation und sein Ehrgeiz. Bald jedoch möchte das Nachwuchstalent etwas Neues ausprobieren. Zuerst versucht er es mit Boxen, was ihm von Anfang an gefällt.
Etwas später kommt der Jugendliche zum ersten Mal mit dem US-amerikanischen Kickboxen in Kontakt – Anfang der 90er eine absolute Neuheit in Europa. Die Kampfsportart, die unter anderem Elemente aus Taekwondo, Karate und Boxen miteinander verbindet, erweist sich schnell als Exportschlager. Und für Mehdi als neue, große Leidenschaft. „Eine Leidenschaft, die bis heute anhält“, betont er. Jahrelang betreibt er vor allem die Formen Leichtkontakt, K1 und Muay Thai (Thaiboxen). Auch als Trainer für Kinder und Jugendliche sammelt er Erfahrungen.
Kampf um Unabhängigkeit
Doch dann, Ende der 1990er Jahre, wird Mehdis Heimat überschattet vom Kosovokonflikt; einem Konflikt, der gezeichnet ist vom albanischen Widerstand gegen Serbien und der letztendlich die Schwelle zum Krieg überschreitet. Was sich zunächst auf innerstaatliche Auseinandersetzungen zwischen Truppen der serbischen Regierung und der paramilitärischen Befreiungsarmee UÇK, die für ein von Serbien unabhängiges Kosovo kämpft, beschränkt, weitet sich später soweit aus, dass sich auch andere Staaten am Krieg beteiligen.
Auch die Bundeswehr ist im Einsatz – es ist ihre erste aktive Beteiligung an Kampfhandlungen seit ihrer Gründung. Das größte Opfer ist, wie so oft bei Kriegen, die zivile Bevölkerung. Serbische Einheiten entvölkern mit ihren „ethnischen Säuberungen“ ganze Landstriche. Die Schlagzeilen dieser Zeit werden beherrscht vom kontrovers diskutierten Luftkrieg der NATO, von gewaltsamen Vertreibungen, von Massakern an der zivilen Bevölkerung.
Das alles veranlasst Mehdi Pestisha, damals Anfang 20, schließlich zur Flucht nach Deutschland. Alleine. „Es war sehr schwer, meine Familie zurückzulassen. Sie wollte dort bleiben, doch ich musste unbedingt weg.“ So wie Hunderttausende seiner Landsleute begibt auch er sich auf die Flucht. Sein Ziel ist Deutschland – und er schafft es. Hessen wird vorerst sein neues Zuhause, hier beantragt er Asyl. „Es war von Anfang an sehr wichtig, Deutsch zu lernen“, sagt der 38-Jährige. „Zum Glück beherrschte ich die Sprache relativ schnell. Dabei hat mir auch der Sport geholfen.“ Denn auch in Deutschland kann der Kosovo-Albaner nicht ohne sein Kickboxen: Er besucht verschiedene Gyms, übernimmt dabei auch immer häufiger die Rolle des Trainers. „Dadurch habe ich schnell Anschluss gefunden in Deutschland. Ich habe sehr nette, hilfsbereite Menschen kennengelernt. Durch die Kontakte fiel es mir viel leichter, Deutsch zu lernen und mich zu integrieren.“

2006, als er sich schon längst in Deutschland eingelebt hat, kommt Mehdi über Umwege ins mittelfränkische Ansbach. Inzwischen hat er eine deutsch-russische Frau, einen kleinen Sohn und eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis. Auch in seiner neuen Heimat bleibt er dem Kickboxen treu, trainiert Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Vor einem Jahr gründet er schließlich seine Kampfsportschule in der Schalkhäuser Straße.
Ein bunt gemischter Haufen
Die zweite Hälfte der Woche ist er immer beruflich unterwegs, passenderweise als Personenschützer. Von Montag bis Mittwoch aber kommt er täglich in den Trainingsraum und bringt seinen Schülerinnen und Schülern all das bei, was er selbst einmal gelernt hat.
Was hier zählt, ist aber nicht nur Leistung. Im Vordergrund steht, sich wohlzufühlen. „Wir sind wie eine große Familie“, bestätigt Firat Akarsu. Seit seiner Jugend trainiert der 27-Jährige bei Pestisha. Er hat einen deutschen Pass, ist aber gebürtiger Türke. „Damit passe ich super in diesen bunt gemischten Haufen“, lacht er.
Tatsächlich haben viele Mitglieder ihre Wurzeln in anderen Ländern, beispielsweise in Rumänien, Russland, den USA und in der Türkei. Der Sport ist für sie ein gemeinsames Hobby, das zusammenschweißt. Da ist es egal, von wo man herkommt. Nicht gern gesehen sind Schläger – unabhängig von der Nationalität.
„Die haben hier absolut nichts zu suchen“, erklärt Mehdi Pestisha nachdrücklich. „Viele Menschen haben leider ein völlig falsches Bild im Kopf: Kickboxen ist aber nichts für aggressive Leute, die ihren Frust ablassen wollen. Man muss nicht einmal besonders kräftig sein für diesen Sport, eine gute Technik ist viel mehr wert. Außerdem werden hier wichtige Werte vermittelt: Selbstvertrauen, Teamgeist, Respekt, die Fähigkeit, zuzuhören und Dinge umzusetzen. Natürlich Fairness und Toleranz. Solche Eigenschaften sind im Kickboxen sehr wichtig, genauso wie in vielen anderen Sportarten auch.“ Vor allem gegenseitiger Respekt wird hier groß geschrieben. Zu Beginn eines jeden Trainings begrüßen sich die Schülerinnen und Schüler und der Trainer mit tiefen Verbeugungen. Nach einem intensiven Warm-up, bei dem sowohl Dehnung als auch Kraft und Kondition trainiert werden, folgen Partnerübungen.

Die zwei Studentinnen Jennifer und Julia sind bereits ein eingespieltes Team. Aufmerksam folgen sie den Anweisungen ihres Trainers – und zeigen, dass es sich beim vermeintlich „schwachen Geschlecht“ lediglich um ein Klischee handelt. Jennifer hält ihre flache Hand nach oben, während Julia einen geschwungenen Axekick ausführt und ihre Hand dabei trifft. Dass Julia erst seit Oktober hier mitmacht und eigentlich aus dem Stabhochsprung kommt, merkt man ihr nicht an.
Die 21-Jährige studiert in Ansbach Biomedizinische Technik. Letztes Jahr nahm sie sich eine Auszeit und ging für zwei Semester in die USA, in die Nähe von Chicago. „Da habe ich mal gefühlt, wie es ist, fremd zu sein in einem Land“, erinnert sie sich. „Dass ich Stabhochsprung betrieb, half mir enorm. Beim Sport lernt man schnell neue, nette Leute kennen, mit denen man viel Zeit verbringt und ein Hobby teilt. Sport fördert einfach extrem das Miteinander, das habe ich in den USA zum ersten Mal realisiert.“


Selbst wenn jemand nicht so gut Englisch konnte, habe man sich eben „mit Händen und Füßen verständigt“. „Sport ist wie eine gemeinsame Sprache“, meint Julia dazu. Ihr Trainer bestätigt das. „Egal, woher jemand kommt, beim Sport zählt nur das gemeinsame Interesse. Das schweißt zusammen“, ist sich Pestisha sicher. Und sein Schüler Firat ergänzt: „Klar, man muss nicht mit jedem ‚best friends‘ sein. Da ist jeder anders. Der Respekt ist jedoch immer da! Für mich jedenfalls sind die Leute hier wie eine zweite Familie.“
Gegen Ende des Trainings verabschiedet Trainer Mehdi seine Schützlinge erst durch das gemeinsame Verbeugen, dann gibt er jedem noch persönlich die Hand. Der 10jährige Sohn des Kosovaren, Fuad, wartet schon auf seinen Vater. Er schaut gerne beim Training „der Großen“ zu. Fuad macht selbst schon seit mehreren Jahren im Kindertraining mit. Dass er bereits mit sieben Jahren Deutscher Meister in seiner Gewichtsklasse im Leichtkontakt war, macht seinen Vater stolzer als ihn selbst.

Schwarz, Rot, Gold
Inzwischen sind seine Schülerinnen und Schüler aufgebrochen, nur noch Fuad ist da und wartet geduldig am Eingang. Bevor der Familienvater das Licht in der Halle löscht, wirft er noch einen letzten Blick auf das große Logo der Kampfsportschule, das direkt an der Wand neben dem Kampfring angebracht ist: Es zeigt die schwarze Silhouette einer Kickboxerin. Dass es sich um eine Frau handelt, erkennt man daran, dass die Figur einen Pferdeschwanz trägt, und auch die Statur spricht dafür; und dass es sich eben um eine Frau handelt, solle auch Außenstehenden verdeutlichen, dass Kickboxen eine Sportart für beide Geschlechter sei, erläutert Mehdi die Gestaltung des Logos.
Mindestens genauso wichtig sind ihm die Farben, die in das Logo integriert sind: Schwarz, Rot und Gold. Der Kickboxtrainer erklärt seine Sicht der Bedeutung. „Ich lebe, gefühlt, schon ewig hier und fühle mich sehr wohl in Deutschland. Mit meiner Frau und meinem Sohn habe ich eine Familie, ebenso mit der Kampfsportschule. Und in meiner Heimat habe ich Familie. Ich besuche sie jeden Sommer für ein paar Wochen. Ich habe nicht nur ein Zuhause, sondern zwei: zum einen Deutschland – deshalb das Schwarz-Rot-Gold – und zum anderen natürlich Albanien, des- sen Flagge Schwarz-Rot ist.“ Mithilfe von Gesten – immer wieder führt er seine Hände zur Brust, legt sie aufs Herz – unterstreicht Mehdi Pestisha seine Worte. Spontan kommt da der Gedanke „Heimat ist da, wo das Herz ist“ in den Sinn. Schließlich knipst er den Lichtschalter aus, sperrt die Tür ab und läuft zu seinem Sohn Fuad. Bevor sich die beiden auf den Heimweg machen, fasst er mit einem Lächeln auf den Lippen zusammen, was er wirklich fühlt: „Ich bin ein deutscher Kosovo-Albaner.“

Wir bedanken uns ganz herzlich bei  Tatjana Schuster für diesen herausragenden Artikel!
Tatjana Schuster für diesen herausragenden Artikel!
Sie möchten gerne mehr über Kickboxen und andere Kampfsportarten erfahren? Melden Sie sich bei uns!